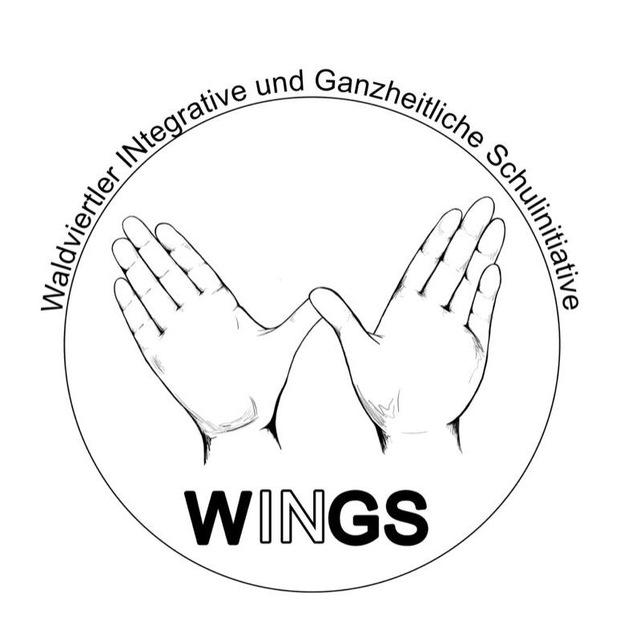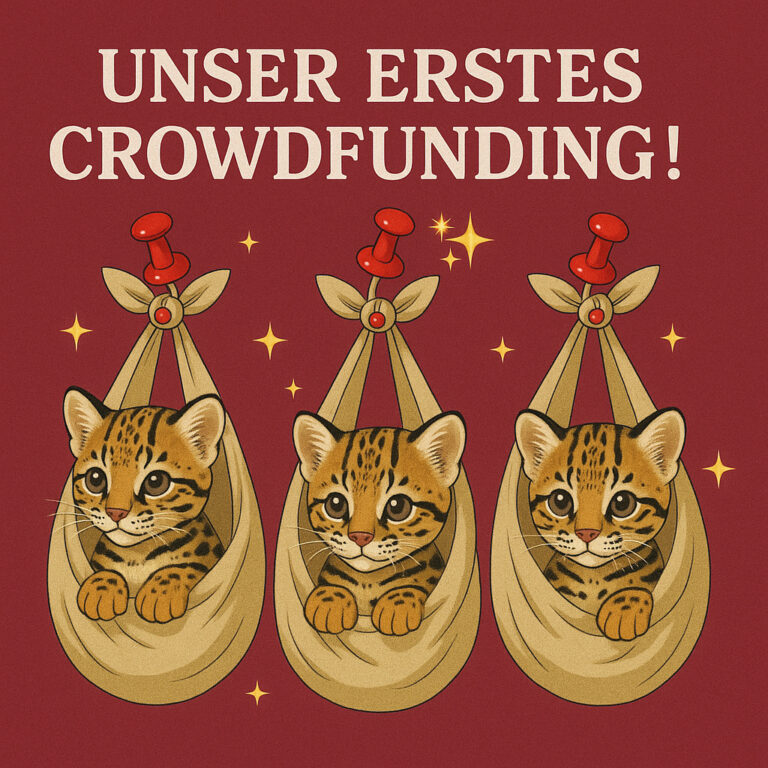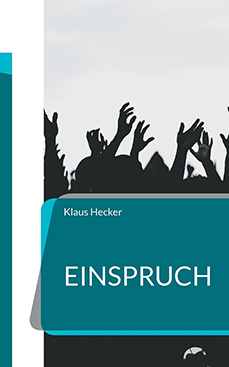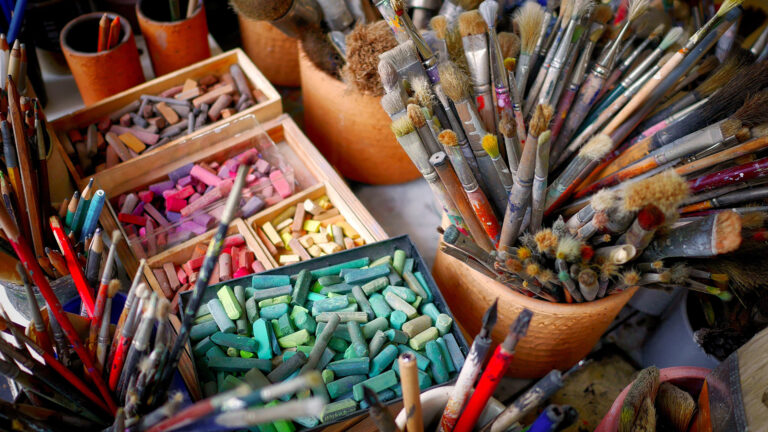Die Zivilisationen müssen die organisierte Gewalt fürchten, die sie trotz aller Widersprüche und historischen Erfahrungen dulden. Inspiriert von Rassismus, Nationalismus und ideologischem Größenwahn ermordete dieses Monster allein im 20. Jahrhundert planvoll über 260 Millionen Menschen.
Durch die weltumspannende Diktatur des Profits, die die Ideologien ablöste, wurde der letzte Lebenszyklus des Kapitalismus erreicht: der totale Imperialismus.
Die von unterschiedlichsten Regimen angeordneten oder geduldeten vorsätzlichen Massentötungen von bestimmten Menschengruppen vereinte der US-amerikanische Politikwissenschaftler Rudolph J. Rummel unter dem Begriff Demozid (1). Die von Rummel für das 20. Jahrhundert aufgestellte Statistik „20th Century Democide“, in der sich der industrielle Massenmord der Nazis ebenso findet wie der Terror des Stalinismus, die Blutspur der Roten Khmer in Kambodscha, das Grauen des Kolonialismus oder der Massenmord an den Kommunisten in Indonesien, zeichnet einen Leichenberg aus 260 Millionen Toten. Dennoch ist es nur ein Ausschnitt dessen, was organisierte Gewalt anrichtet, weil auch jede Form des Krieges organisierter Massenmord ist.
Der große Sprung
Rummel klammerte in seiner Definition die Toten aus, die auf das Konto von internationalen Kriegen und innerstaatlichen Bürgerkriegen gehen, und fast alle Leichen, die eine unbeabsichtigte Nebenerscheinung von Regierungshandlungen gewesen sind. Beispielhaft für diese Art der „fahrlässigen“ oder „unbeabsichtigten“ Massenvernichtung steht die Ende der 1950er-Jahre in China einsetzende Hungersnot.
Der Tod von geschätzt rund 20 bis zu 50 Millionen Menschen war ein Resultat des gescheiterten und als „Großer Sprung nach vorn“ bekannten Versuchs, die Volksrepublik binnen weniger Jahre in ein Paradies der Stahlindustrie zu verwandeln. Trotz des Nahrungsmangels, der durch die Vernachlässigung der landwirtschaftlichen Produktion und in Kombination mit Dürreperioden einsetzte, wurde an dem Vorhaben bis Anfang der 1960er-Jahre festgehalten.
Den industriellen Rückstand gegenüber den kapitalistischen Staaten zu verringern, sich von der UdSSR weiter zu emanzipieren und am Ende eigene Fehleinschätzungen zu verschleiern, war dem Regime wichtiger als Menschenleben. Ein Hilfsangebot der Sowjetunion wurde abgelehnt.
Entsprechend dieser historischen Erfahrung lässt sich organisierte Gewalt nicht nur unter anderem durch die theoretische Planung, sachliche Vorbereitung und die spezifische Ausführung von Massentötungen kennzeichnen, die durch Strukturen und Einrichtungen — Militär, Polizei, Geheimdienste, paramilitärische Einheiten, Todesschwadronen und so weiter — erfolgen, die allein oder (arbeitsteilig) im Verbund handeln. Auch die „ungewollte“ Massenvernichtung, eine Art Betriebsunfall im realpolitischen Ablauf, ist ohne die Beihilfe der organisierten Gewalt nicht denkbar.
Zwischen Killing Fields und Todesfabriken
Die systematische Zerstörung von moralischen und humanistischen Werten und die Fokussierung auf ein Feindbild gehen der bewussten oder fahrlässigen Vernichtung voraus. Zur Beseitigung von Widerstand und zur intellektuellen Gleichschaltung der Massen, wahlweise als Staatsvolk oder Souverän bezeichnet, erschaffen kulturelle, politische und juristische Instanzen eine künstliche Legitimation wie zum Beispiel im Dritten Reich durch die Installation der Rassengesetze (2). Die Verrechtlichung des Unrechts sorgte für die Befreiung von persönlicher Schuld, die Uniform der Pflicht für ein sauberes Gewissen.
Diese Kombination hat Langzeitwirkung. Noch nicht einmal unter dem geschichtlichen Eindruck der NS-Todesfabriken oder den Killing Fields im Demokratischen Kampuchea wurden die Strukturen der organisierten Gewalt weltweit beseitigt. Costa Rica zeigte, dass es möglich ist. Die Armee wurde am 1. Dezember 1948 abgeschafft (3). Die Verfassung verbietet die Aufstellung von Streitkräften in Friedenszeiten. 1983 erklärte das Land seine dauerhafte Neutralität. Ausgaben für „Verteidigung“ gibt es im Staatshaushalt nicht. Das Geld wird in das Gesundheitswesen und die Bildung investiert (4).
Trotz seiner radikalen Entmilitarisierung konnte sich Costa Rica dem Sog der Gewalt nicht entziehen. Im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg, einem Produkt unter anderem der Massenverelendung in Lateinamerika und der steigenden Nachfrage nach Drogen in den USA und Europa, wurden Mitte der 1990er-Jahre paramilitärische Einheiten aufgestellt, um den Drogenschmuggel in den Grenzregionen zu Nicaragua und Panama zu unterbinden. 2010 kamen trotz massiver Proteste US-amerikanische Militäreinheiten ins Land, um den Kampf gegen die Rauschgiftkartelle zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten. So war zumindest die offizielle Erklärung für die zeitweise Stationierung von über 40 Kriegsschiffen, Kampfhubschraubern und 7.000 US-Marines (5).
Die Schneide des Rasiermessers
Gewisse Ähnlichkeiten zu den wirtschaftlichen Zielen, die das Regime in China unter Mao Zedong mit dem „Großen Sprung“ verfolgte, sind in den gegenwärtigen Anstrengungen westlicher Volkswirtschaften auszumachen. Mit der Brechstange versuchen sie, sich in digitale Wirtschaftsstandorte zu „transformieren“, um die fortschreitende Deindustrialisierung, die im Zusammenhang mit dem angeschlagenen Finanzkapitalismus zu sehen ist, aufzufangen. Durch mehr oder minder wirksame infrastrukturelle und ökologische Anpassungen wird ein wirtschaftlicher Aufbruch inszeniert. Dabei haben sich die Staaten schon hoffnungslos in einem Netz aus Währungsabwertung, Defizit und Vermögensblasen verfangen.
Fabio Vighi beschreibt in dem Sammelband „COVID-19 und die Pandemie als Amoklauf des Finanzkapitals“ (pad-Verlag) das Szenario, das sich vor aller Augen entfaltet:
„Die Wahl, vor die wir gestellt werden, ist dieselbe, die wir in der Geschichte der fortgeschrittenen Industriegesellschaften gesehen haben: Inflation oder Deflation. Entweder wird Geld als allgemeines Äquivalent abgewertet (Inflation), oder der Abwertungsprozess wirkt sich direkt auf das Kapital aus, sodass die Produktion (Fabriken und Arbeiter) plötzlich überflüssig wird. Anders als in der Vergangenheit bedeuten heute jedoch sowohl Inflation als auch Deflation eine Entwertung des Fiat-Geldes mit dem zusätzlichen Bonus eines Systemzusammenbruchs“ (6).
Dass die nachlassende Konkurrenzfähigkeit gegenüber Nationen wie China, Indien oder Brasilien zu kompensieren sei — das heißt, ein signifikantes Wachstum der westlichen Realwirtschaft eintritt, das die Fata Morgana der Börsenrallys vertreibt —, ist Wunschdenken. Das Finanzsystem ist kaputt und befindet sich an einem Kipppunkt. Fabio Vighi spricht von einer „Alles-Blase“, entstanden durch die Flutung der maroden Finanzmärkte mit „magischem Geld“:
„Da immer mehr Geldspritzen nötig sind, um die Schuldenblase zu stützen, die die Finanzmärkte vor dem Zusammenbruch bewahrt, muss die reale Nachfrage gedrosselt werden, um einen Inflationsschub zu verhindern, der leicht aus dem Ruder laufen könnte. (…) Was uns bleibt, ist eine Produktionsweise, die nur aus Hut und Cowboy besteht, ein stotternder Wirtschaftsmotor, der seine Ohnmacht leugnet. Doch wir können sicher sein, dass auch die aktuelle „Alles-Blase“ platzen wird, genau wie die vorangegangenen. Und da das Volumen des fiktiven Kapitals heute viel größer ist als je zuvor, wird die Verpuffung noch viel heftiger ausfallen“ (7).
Nach einem Crash, der die Währungen pulverisieren würde, wären Unruhen, Aufstände und andere Konfliktformen bis hin zu Revolutionen in den Entwicklungs- und den Industrieländern die Folge. Überall würden die bestehenden Herrschaftssysteme und die Diktatur des Profits von den revoltierenden Volksmassen herausgefordert. Diesen aufziehenden Orkan gilt es seitens des Systems zu verhindern oder ihn zumindest abzuschwächen.
Vighi schreibt, dass die „Finanzscharade nur fortgesetzt werden kann, wenn die in die Höhe schießenden Schuldenbestände umgeschichtet werden“. Dazu sei die Hilfe einer endlosen Abfolge von „exogenen ‚Unfällen‘ erforderlich — eine Strategie, die inzwischen so verzweifelt ist, dass sie sogar in Massenmord durch Kriegsexpansion oder andere Mittel gipfeln könnte“.
Werden die Varianten der organisierten Gewalt zu Kompensationsmitteln für das fiktive Kapital, balanciert die Menschheit auf der Schneide eines Rasiermessers. Seine Schärfe zeigt sich, wenn Marktwirtschaft und Gewalt aufeinandertreffen und die materialistischen Aspekte beachtet werden, die das Streben nach Profit hervorbringt.
Auf den Märkten der Gewalt
Der deutsche Ethnologe Georg Elwert (1947 bis 2005), der den Begriff Gewaltmarkt in die Sozialwissenschaften einführte, erkannte bei seinen Analysen die politische Strategie, Gewalt in sozialen Räumen zu nutzen beziehungsweise zweckorientiert einzusetzen, um marktwirtschaftliche Interessen zu befriedigen.
Das gelingt insbesondere in Staatskonstruktionen, in denen ein umfassendes Gewaltmonopol nicht mehr existiert, weil es zerfallen ist, sich zurückzieht und auch kein anderes Regime in der Lage ist, ein neues Gewaltmonopol durchzusetzen. Die Darstellung ist sehr grob, erlaubt aber eine Orientierung, warum sich Kriege, Bürgerkriege, innerstaatliche und sonstige bewaffnete Konflikte teilweise über Jahrzehnte hinziehen, obwohl eine politische Einigung und Frieden in greifbarer Nähe zu sein scheinen.
In Myanmar beispielsweise, besser bekannt als Burma, beseitigte der britische Kolonialismus Ende des 19. Jahrhunderts quasi mit der Waffe in der Hand die natürliche Ordnung. Das Gebiet wurde eine Provinz von Britisch-Indien. Um sie besser kontrollieren und ausbeuten zu können, wurde versucht, eine Verwaltungsstruktur zu installieren. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Region in Südostasien weder geographisch noch politisch als Einheit betrachtet. Unterschiedliche Ethnien besiedelten das Gebiet, das an Laos, Thailand, China, Indien und Bangladesch grenzt.
Ähnlich wie in Afghanistan änderte die Kolonialmacht die traditionellen Verhältnisse und importierte ein ihm dienliches bürokratisches Staatswesen. Die aufgezwungene neue Ordnung setzte sich aber nicht durch. Der Drang nach Unabhängigkeit war größer als die Bereitschaft, sich einem Aggressor zu unterwerfen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab Großbritannien seine kolonialen Bestrebungen auf. Zurück blieb ein fragiles Staatsgebilde.
Seit der Unabhängigkeit 1948 (!) kämpfen bewaffnete Rebellengruppen aus unterschiedlichsten ethnischen Minderheiten mehr oder weniger intensiv für ihre Autonomie und Unabhängigkeit. Ihr Feind ist die Zentralregierung, in der Gegenwart eine Militärjunta, die versucht, ihre Machtposition mit Hilfe ihrer Armee und verbündeter Milizen zu erhalten. 2021 eskalierte der Konflikt. Es entwickelte sich ein Bürgerkrieg, der von allen Seiten mit äußerster Brutalität und Verbissenheit geführt wird. Die Ausgaben für Militär, Polizei und Geheimdienste machen über 50 Prozent des Staatsbudgets aus. Die zivile Wirtschaft und das Gesundheitswesen sind weitestgehend zusammengebrochen. Die Zentralregierung kontrolliert weniger als 20 Prozent des Landes. Der Staat fällt auseinander.
Alle Konfliktparteien haben eine Gemeinsamkeit: Sie brauchen Geld, Ausrüstung, Waffen und Munition. Das ist ein Baustein für die Etablierung eines Gewaltmarktes und der Nährboden für die organisierte Kriminalität.
Drogenhandel, Glücksspiel, Online-Betrug und der Schmuggel von Holz und Edelsteinen gehören zu den Finanzierungsquellen. Die Volksrepublik China, die im Arakan-Staat, einer der 15 Verwaltungseinheiten von Myanmar, mit dem Tiefseehafen Kyaukphyu am Indischen Ozean als Umschlagplatz für Erdöl und Erdgas eigene Wirtschaftsinteressen verfolgt, liefert, was der Gewaltmarkt vor seiner Haustür benötigt. Praktisch alle Konfliktparteien sind als Kunden willkommen.
Der zivilisatorische Rückschritt
Wo externe Akteure wie Söldnerfirmen, War Lords, Waffenhändler und so weiter — aber auch Staaten und Konzerne, die sich den Zugriff auf Ressourcen sichern wollen oder geopolitische und -strategische Absichten verfolgen und dafür auf die Dienste von beispielsweise Militärfirmen zurückgreifen — in einen Konflikt eintreten, dessen Ausgangspunkt politischer, ethnischer oder religiöser Natur gewesen ist, kann das ökonomische Motiv des materiellen Profits die Oberhand gewinnen.
Zur Befriedung des Konflikts werden die genannten Akteure nichts Substanzielles beitragen, weil sie kein Interesse daran haben können, dass die Auseinandersetzungen, von denen sie materiell partizipieren, ein Ende finden.
Dieser Effekt wird verstärkt, je mehr die vormals „friedlichen“ Bereiche der Wirtschaft zerfallen. Kehrt keine überdauernde Beruhigung ein, sodass sich Handel, Produktion und Verwaltung stabilisieren und Versorgungssicherheit eintritt, blutet das Gemeinwesen aus. Krieg — und seine Auswüchse — wird für signifikante Teile der Bevölkerung zur einzigen Option, um Einnahmen zu erzielen und das eigene Überleben zu sichern. Das hat langfristig fatale Konsequenzen.
Gescheiterte Staaten, „failed states“, wie Somalia, der Sudan oder Libyen, das nach dem Sturz und der Ermordung von Muammar al-Gaddafi immer tiefer im Bürgerkrieg versank und 2014 in einen West- und einen Ostteil zerbrach, sind nicht nur Tummelplätze für bewaffnete Banden, Menschenhändler, Waffenschieber und andere kriminelle Gruppierungen. Sie sind Ausdruck eines gravierenden zivilisatorischen Rückschritts und gesellschaftlichen Verfalls, der nicht mehr kompensiert werden kann. Genauer gesagt: Die Diktatur des Profits, die sich durch die Ökonomie der Gewalt zu retten versucht, geht zum totalen Imperialismus über und frisst die Staatsgebilde auf.
Text von: Gunther Sosna
Quellen und Anmerkungen:
(1) Rudolph Joseph Rummel: 20th Century Democide. Verfügbar auf http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM, abgerufen am 16.2.2025.
(2) Dokumente des Nationalsozialismus. Verfügbar auf https://www.servat.unibe.ch/dns/dns_tant.html, abgerufen am 16.2.2025.
(3) taz (4.7.2010): Blanko-Scheck zur Invasion. Verfügbar auf https://taz.de/US-Truppe-im-entmilitarisierten-Costa-Rica/ !5139667/, abgerufen am 17.2.2025.
(4) Trading Economics: Wirtschaftsindikatoren von Costa Rica. Verfügbar auf https://de.tradingeconomics.com/costa-rica/indicators, abgerufen am 17.2.2025.
(5) America21 (9.7.2010): Massive Militärpräsenz der USA in Costa Rica. Verfügbar auf https://amerika21.de/analyse/3252/militramerikas , abgerufen am 17.2.2025.
(6) Fabio Vighi: COVID-19 und die Pandemie als Amoklauf des Finanzkapitals, S. 62 (pad-Verlag, Bergkamen 2024).
(7) Ebd., S. 67
Hinweis: Das Essay ist der vierteTeil einer vierteiligen Beitragsserie, die unter anderem in der Schweiz im Magazin Zeitpunkt und bei Manova veröffentlicht wurde.
Symbolfoto: Sergey Kotenev, Unsplash.com