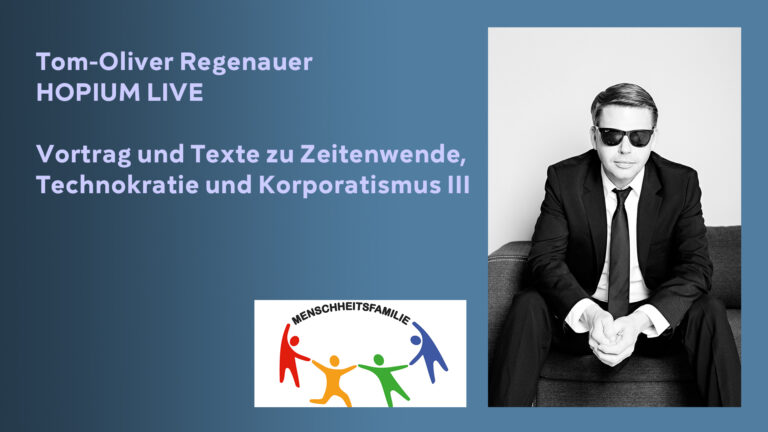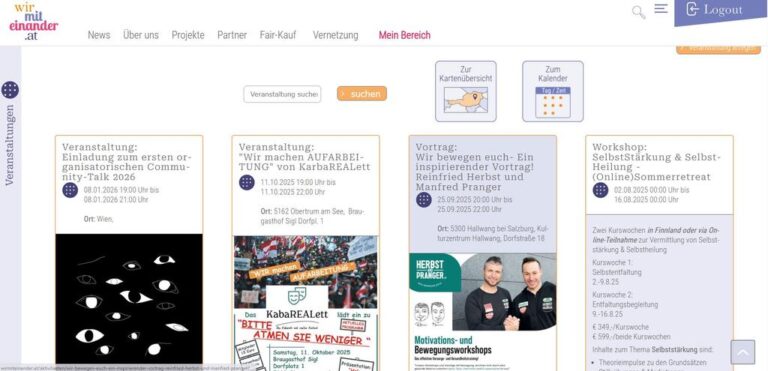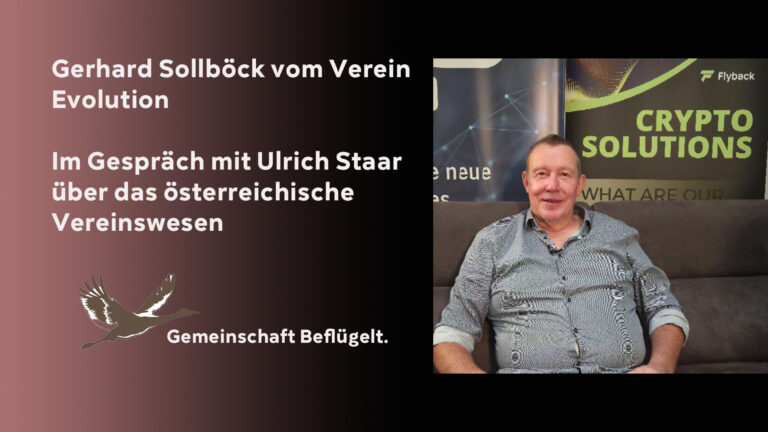Seit 8.8.25 ist das von der EU schon im Vorjahr in Kraft gesetzte „Europäische Medienfreiheitsgesetz“ – oder wie es in der Langform heißt – die „VERORDNUNG (EU) 2024/1083 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. April 2024 zur Schaffung eines
gemeinsamen Rahmens für Mediendienste im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU“ in vollem Umfang gültig. Die
darin propagierte Freiheit aber liegt einzig und allein darin, die Mächtigen zu legitimieren, Medienfreiheit nach ihrem Gutdünken
einzuschränken.
Schon die Bezeichnung „Medienfreiheitsgesetz“ ist nicht nur Euphemismus oder Schönfärberei, sondern eine glatteLüge. Auf den ersten etwas mehr als 20 von insgesamt 37 Seiten werden in 78 Absätzen die Gründe für diese Verordnung erläutert, ehe auf Seite 21 der eigentliche Gesetzestext beginnt.
In gedrechseltem Juristendeutsch stehen da Sätze, die an Plattheit und Unzulänglichkeit kaum etwas zu wünschen übrig lassen. Beim genauen Lesen kann einem dabei zwar schwindlig werden, aber man sollte sich von diesem Wortschwall keineswegs überfordern und schon gar nicht zur Aufgabe zwingen lassen. Texte wie dieser haben auch das Ziel, Menschen am Mitkommen zu hindern und sie zum Schluss kommen zu lassen, dass „die da oben schon wissen werden, was gut und richtig ist“ oder „dass man dagegen halt eh nix machen kann“.
Schon der einleitende Absatz (1) verkennt die aktuelle Lage der Medien. Darin heißt es:„Unabhängige Mediendienste spielen eine einzigartige Rolle im Binnenmarkt. Sie stellen einen sich rasch verändernden und wirtschaftlich wichtigen Sektor dar, der Bürgern und Unternehmen Zugang zu einer Vielfalt an Meinungen und zuverlässigen Informationsquellen bietet und damit die im Allgemeininteresse liegende öffentliche Wächterfunktion erfüllt und für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess unerlässlich ist.“
Auch im Absatz (2) geht’s munter weiter mit diesem Narrativ, wenn folgendes geschrieben steht: „Angesichts der einzigartigen Rolle von Mediendiensten stellt der Schutz der Medienfreiheit und des Medienpluralismus als zwei der tragenden Säulen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ein wesentliches Merkmal eines gut funktionierenden Binnenmarkts für Mediendienste dar.“
Schön wär’s, denkt man sich und wundert sich vielleicht, warum da ständig vom „Binnenmarkt“ die Rede ist. Das aber könnte auch ein Hinweis sein, dass es in erster Linie um Wirtschaftliches geht und wie man ungeliebten Medien beikommen will. Man beginnt zu ahnen, dass auf den nächsten Seiten wohl in Gesetzesform gegossen wird, was unabhängigen Journalisten und Plattformen in den letzten Jahren schon „illegal“ zugemutet wurde, bis hin zu den gängigsten Maßnahmen wie Cancelling und Demonetarisierung.
Im Absatz (4) wird’s dann Gewissheit, wohin der Hase läuft: „Der Binnenmarkt für Mediendienste ist jedoch nicht ausreichend integriert, und er ist von einem gewissen Ausmaß an Marktversagen geprägt, das durch die Digitalisierung noch gesteigert wird. Erstens fungieren globale Online-Plattformen als Zugangstor zu Medieninhalten mit Geschäftsmodellen, die dazu neigen, den Zugang zu Mediendiensten zu unterbinden und polarisierende Inhalte und Desinformation zu verstärken. Diese Plattformen sind auch wesentliche Anbieter von Online-Werbung, was finanzielle Mittel vom Mediensektor wegverlagert hat, was dessen finanzielle Tragfähigkeit und folglich die Vielfalt der angebotenen Inhalte beeinträchtigt.“
Obwohl in den weiteren Absätzen immer wieder von redaktioneller Freiheit und dem Erhalt des Medienpluralismus sowie der Meinungsfreiheit die Rede ist, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hinter diesen hehren Formulierungen ganz anderes verborgen liegt.
Im Absatz (37) wird dann klar, wie die Umsetzung dieser Grundsätze geschaffen werden soll: „Um für eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung und anderer Medienrechtsvorschriften der Union zu sorgen, ist es erforderlich, das Gremium als ein unabhängiges Beratungsgremium auf Unionsebene einzurichten, in dem nationale Regulierungsbehörden oder -stellen vertreten sind und deren Maßnahmen koordiniert werden.“ Damit ist wohl nichts anderes gemeint, als die Schaffung eines
zentralisierten EU-weiten „Wahrheitsministeriums“. Ihr unterstellt sind die nationalen Regulierungsbehörden, die schauen
sollen, dass im jeweiligen Land die Medienfreiheit nicht zu weit geht.
Im Verordnungstext selbst wird diese Sichtweise dann deutlich untermauert.
In Artikel 4 Absatz (3) werden die Mitgliedsstaaten zwar dazu verpflichtet, „keine der folgenden Maßnahmen“ zu ergreifen, nämlich u.a. „Verpflichtung von Mediendiensteanbietern oder deren redaktionellen Personals Informationen offenzulegen, die mit journalistischen Quellen oder vertraulicher Kommunikation im Zusammenhang stehen oder diese identifizieren können“ oder „Inhaftierung, Sanktionierung, Abfangen oder Untersuchung von Mediendiensteanbietern oder deren redaktionellen Personals oder Überwachung, Durchsuchung oder Beschlagnahme von diesen oder von deren Geschäfts- oder Privaträumen, um Informationen zu erhalten, die mit journalistischen Quellen oder vertraulicher Kommunikation im Zusammenhang stehen oder diese identifizieren können“ und weiter: „Einsatz von intrusiver Überwachungssoftware auf jegliche(s) Material, digitale Geräte, Maschine oder Instrumente, die von Mediendiensteanbietern, deren redaktionellem Personal oder von jeglichen Personen genutzt werden, die aufgrund ihrer regelmäßigen oder beruflichen Beziehung zu einem Mediendiensteanbieter oder dessen redaktionellem Personal über Informationen verfügen könnten, die mit journalistischen Quellen oder vertraulicher Kommunikation im Zusammenhang stehen oder diese identifizieren können“.
Gleichzeitig aber werden in Absatz (4) die Mitgliedstaaten ermächtigt, „eine der darin genannten Maßnahmen“ unter bestimmten Voraussetzungen dennoch treffen zu dürfen, nämlich wenn es „Unionsrecht oder nationalem Recht vorgesehen“, „mit Artikel
52 Absatz 1 der Charta und anderem Unionsrecht im Einklang“, „im Einzelfall durch einen überwiegenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt und … verhältnismäßig“, „vorab von einer Justizbehörde oder einem unabhängigen und unparteiischen Entscheidungsgremium zugestimmt worden oder, in hinreichend gerechtfertigten und dringenden Ausnahmefällen, nachträglich unverzüglich durch eine solche Behörde oder ein solches Gremium genehmigt worden“ ist.
Der Willkür sind damit nun auch legistisch Tür und Tor geöffnet. Und in den weiteren Ausführungen der Verordnung wird klar, dass auch Online-Plattformen, die nicht in dem genannten Sinn funktionieren, ein schweres Leben bevorsteht, weil sie Inhalte – wie es in den letzten Jahren etwa bei Youtube zu beobachten war – vorab überprüfen und im Zweifelsfall zensurieren bzw. canceln müssen.
Staatliche Narrative, die von eilfertigen „Mediendienstanbietern“ unkommentiert weiter gegeben werden, werden wohl weiterhin von den beschriebenen Maßnahmen ausgenommen bleiben, allen kritischen Stimmen stehen schwere Zeiten bevor. Wie in vielen anderen Bereichen ist die nun gültige Verordnung zum Zwecke der „Sicherheit“ im Medienbereich zur Bekämpfung von Desinformation und Fake News eine absolut willkürliche und gefährliche Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, die so nicht hingenommen werden darf. Der Kampf für diese grundlegenden Freiheiten, die u.a. Edward Snowden und Julian Assange vor einigen Jahrzehnten schon vorbildhaft eingeleitet haben, muss also jetzt erst recht beginnen und von uns allen
mitgetragen werden. Sonst erwachen wir eines schon recht nahen Tages in einer der dystopischen Welten, die uns etwa Ray Bradbury in „Fahrenheit 451“ oder George Orwell in „1984“ eindrücklich vor Augen geführt haben. Noch aber ist es nicht zu spät.
Text von: Michael Karjalainen-Dräger
https://mkdreports.substack.com
Bildrechte Schreibmaschine:
Bild von Gundula Vogel auf Pixabay