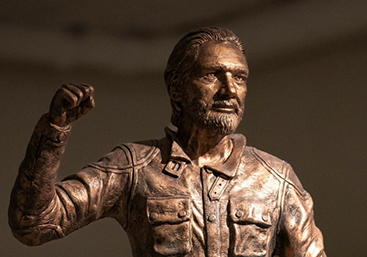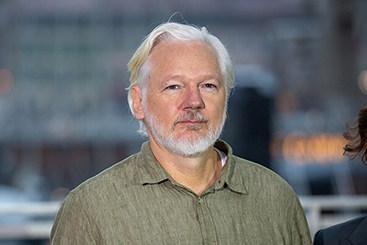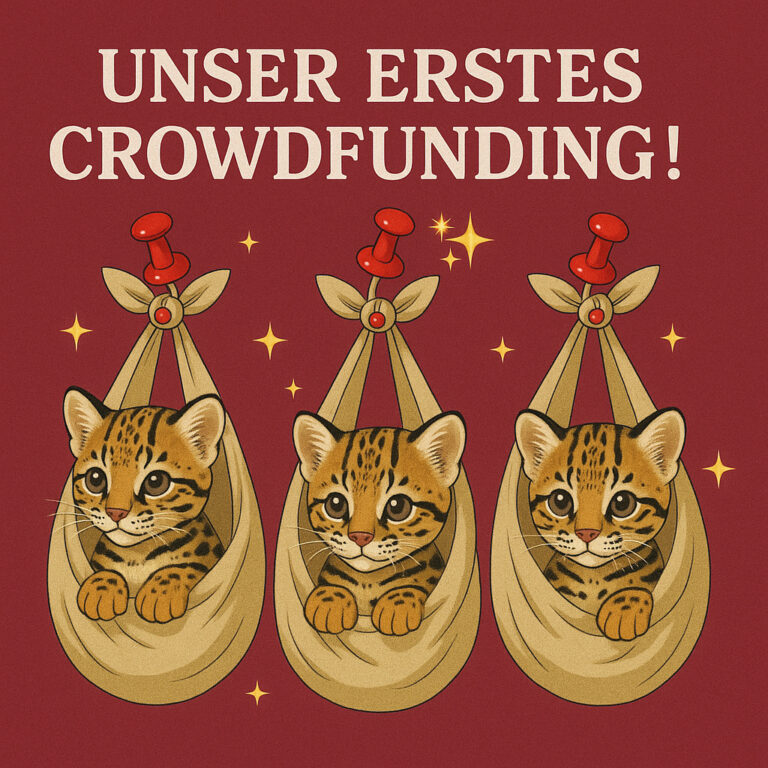FreiSein mit Kunst, die Freude schafft
Text von Daniela Lupp
Heute, am 25. Oktober 2025, wollen wir nicht nur einem der größten Komponisten zu seinem 200. Geburtstag huldigen, sondern vor allem dem Menschen hinter dem Walzerkönig – jenem Mann von seltener Sanftmut, tiefem Pflichtgefühl und unaufgeregter Menschlichkeit, von dem uns die Berichte erzählen. Er lebte und wirkte in einer Zeit, in der sich – wie heute – eine Wende ankündigte, während das Alte zu einem Ende getrieben wurde.
Der Mensch: Liebenswürdigkeit als Lebenskunst
Über den Künstler Johann Strauß ist viel geschrieben worden – den Menschen kennen nur wenige“, schrieb einst seine Frau Adéle. „Und doch hat dessen persönliche Wesensart vielleicht mehr als sonst auch die künstlerische bestimmt. Echte Liebenswürdigkeit, vom Wiener Grundton durchzogen, nahm alle gefangen, die ihm begegneten. Sein Lächeln, sein schalkhaft blitzendes Auge, sein bezaubernder Humor übersonnten alle Nichtigkeiten des Alltags, alle Banalitäten des Lebens. Naiv wie ein
Kind, war er doch ernst und bedacht in Fragen seiner Kunst. In seiner wahrhaft übertriebenen Bescheidenheit war er der strengste Beurteiler seiner Arbeit, am glücklichsten in der Einsamkeit seines Studios und engsten Häuslichkeit …“ (Pahlen: S. 173-174).
Johann Strauß Sohn wurde am 25. Oktober 1825 geboren. Seine musikalische Geburtsstunde fand am 15. Oktober 1844 statt, als „Schani“, wie er in Wien liebevoll genannt wurde, sein glanzvolles Debüt im Café Dommayer hatte. Und das gegen den Willen seines Vaters, Johann Strauß. Den drei Söhnen verbot dieser strengstens, musikalisch in seine Fußstapfen zu treten. Er wählte stattdessen bürgerliche Berufe für sie. Sein Ältester sollte Kaufmann werden. Ein Brief des Sohnes ist erhalten, den er mit „Innigst geliebter Vater!“ beginnt. „Er habe beschlossen, fährt er fort, im schweren Herzensstreit, in den er durch den Gegensatz zwischen Rechtsgefühl und kindlicher Liebe geraten, seine Talente ausbilden zu lassen, was der Mutter zu verdanken sei, die nach den jetzigen Verhältnissen ohne Schutz und Hilfe dastehe und der er mit seinen geringen Kräften in seinem Erwerbszweig den Dank abstatten möchte.“ (Pahlen: S. 187)
Schani wuchs in einem zerrissenen Haushalt auf. Der Vater hatte die Familie verlassen, um mit seiner Geliebten ein neues Leben zu beginnen. Ihm blieb die Verantwortung, und er kam ihr verantwortungsvoll nach: Mit kaum zwanzig Jahren versorgte Johann Strauß Junior Mutter und vier Geschwister. Diese Fürsorge beschränkte sich nicht auf die eigene Familie. Strauß war zeitlebens außerordentlich spendenfreudig und trat regelmäßig, oft unentgeltlich, bei Benefizveranstaltungen auf. Diese stille Großzügigkeit war kein Kalkül, sondern Ausdruck jener bescheidenen Menschlichkeit, die Zeitgenossen so an ihm schätzten.
Wie weit die damaligen familiären Rivalitäten genau gingen, von denen die tragödienbegeisterten Wiener zu berichten wussten, ist nicht eindeutig. Von Schani selbst scheint es kein schlechtes Wort über den Vater gegeben zu haben. Über dessen Musik sagte er: „Seine Kunst hat manche Sorgen verscheucht, manche Falte geglättet, vielen den Lebensmut gehoben, die Lebensfreude zurückgegeben, sie hat getröstet, erfreut, beglückt, und darum wird die Menschheit ihm sein Andenken bewahren.“
(Pahlen: S. 173)
Der Sohn war vollkommen anders als der Vater, der – wie man sagte – wie ein Besessener schien, ein Getriebener war, manchmal sogar an einen Dämon erinnernd. Der „Walzerkönig-Kronprinz“ war von ruhiger Natur, freundlich, eigentlich wenig widerspenstig. Eigentlich …
Der Widerspenstige: Freiheit im Walzertakt
Hinter Schanis Sanftmut verbarg sich ein Idealist. Er war kein politischer Mensch, jedoch freiheitlich gesinnt und trat gegen die
Ungerechtigkeiten des damaligen österreichischen Regimes auf. Staatskanzler Metternich regierte in kaiserlichem Auftrag mit harter Hand, durch Unterdrückung, Überwachung und Zensur. Doch 1848 kam es zur Revolution. Kaiser Ferdinand soll erstaunt gefragt haben: „Ja, dürfen’s denn das?“ Der junge Strauß sympathisierte mit studentischen Revolutionären. Er komponierte den Revolutions-Marsch, die Freiheits-Lieder, den Studenten-Marsch, den Liguorianer-Seufzer-Polka. Und er ging weiter: Am 3. Dezember 1848 führte er im Saal beim grünen Tor in der Josefstadt dreimal öffentlich die Marseillaise auf – ein Akt, der olizeilich
protokolliert ist. In einem Verhör rechtfertigte er sich: Er habe es auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums getan. Ob Wahrheit oder Taktik – der Mut war unbestreitbar.
Schon bei seinem ersten öffentlichen Auftritt hatte er mit einem Lied aus der Revolutionsoper „Die Stumme von Portici“ gestartet. Deren Aufführung hatte 1830 in Brüssel zu einem Aufstand geführt, wodurch es schließlich zur Loslösung Belgiens von den Niederlanden kam. Das alles war kein jugendlicher Leichtsinn. Er nutzte seine künstlerische Stimme, um Missstände aufzuzeigen. Archivakten belegen: „Er war früher Kapellmeister eines Bürgerregiments … trat aber nach dessen Auflösung im Jahre 1848 … bei der Nationalgarde ein … und produzierte revolutionäre Märsche.“ (Pahlen: S. 207) Nachdem auch der jüngere Brüder Josef, später ebenfalls Komponist und Kapellmeister, mit Revolutionären verkehrte, kam es im Hause Strauß sogar zu einer polizeilichen Durchsuchung.
Die Revolution zog vorüber, ohne dass sich grundlegend etwas geändert hätte. Der Wiener Schmäh blieb erhalten, ebenso die Liebe zum Walzer und zu den schönen Seiten des Lebens. Man hatte – eine vorübergehende – Pressefreiheit erreicht, Staatskanzler Metternich hatte abgedankt und ein neuer, junger Kaiser kam auf den Thron, in den man Hoffnungen auf
Wandel und Erneuerung setzte. Die Niederschlagung der Aufstände und die Wiederherstellung der alten Ordnung beklatschte man damals und heute im Radetzkymarsch, dem berühmtesten Werk von Johann Strauß Vater.
Ein – jedoch spärlich dokumentiertes – Ereignis soll noch erwähnt sein. Es soll behördlich festgehalten worden sein. Demnach kam es im Jahr 1853 bei einem öffentlichen Konzert im Wiener Prater zu einer Panik, ausgelöst durch eine zeitgleich stattfindende Militärübung. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, ein 14-jähriges Mädchen kam zu Tode. Johann Strauß, tief erschüttert über das Geschehen, wollte seine Anteilnahme zeigen. Jedoch wurde ihm behördlich untersagt, bei der
Beerdigung des Mädchens zu spielen – entweder aufgrund der angespannten Stimmung nach dem Vorfall oder weil man sich noch lebhaft an seine revolutionären Tendenzen im Jahr 1848 erinnerte. Strauß soll sich dem Verbot widersetzt und vor dem Friedhofstor einen Trauermarsch gespielt haben – eine kühne Geste gegen staatliche Willkür.
Die Konsequenzen trug er lange. Ein Polizeibericht von 1856 diffamierte ihn als „leichtsinnigen, unsittlichen und verschwenderischen Menschen“ – eine offensichtliche Falschmeldung, die ihm den Titel des k.k. Hofballmusikdirektors lange vorenthalten sollte. Obwohl er Wiens beliebtester Musiker war, erhielt er das Amt erst 1863 – 15 Jahre nach der Revolution. Es sei angemerkt, dass 1846 dem Vater diese Ehrung zuteil wurde – inmitten seines Scheidungsprozesses in einem streng katholischen Land unter absolutistischer Herrschaft.
Der Musiker: Poesie im Dreivierteltakt
Auch oder vor allem in seiner Musik zeigte sich Johann Strauß Sohn revolutionär. Zwar trat er scheinbar in die Fußstapfen seines Vaters, doch er schuf etwas Neues: Walzer, die nicht nur beschwingt, sondern kunstvoll, vielschichtig, emotional tiefgründig waren. Er kreierte ein moderneres Erlebnis durch einen neuen Walzertypus. Der einst unbedeutende Sohn wurde zum ernsthaften Rivalen und überstrahlte den Vater bald musikalisch und in der öffentlichen Wahrnehmung. Johann, der Ältere, bekam das jedoch nicht mehr in vollem Umfang mit. Er verstarb im Jahr 1849 an Scharlach. Der Titel „Walzerkönig“ ging beinahe postwendend an den „Thronfolger“ über. Das Orchester teilte Schani bald mit seinen zwei jüngeren Brüdern, Josef und Eduard; er jedoch brachte seine Musik nicht nur in Tanzcafés und Ballsäle, sondern später sogar in Opernhäuser.
Johanns Debüt 1844 war mehr als ein Konzert – es war eine Offenbarung. Als er den Geigenbogen hob, „wurde es langsam ruhig im Saal“. Er entfesselte eine „ungeheure Kraft … einen Schwung, den man hätte revolutionär nennen können, der aber nur aus der Musik zu kommen schien“ (Pahlen: S. 193). Sein Walzer Sinngedichte musste an jenem Abend19 Mal wiederholt werden – ein Triumph, den selbst der Vater nie erreichte.
Doch Strauß’ Genie lag nicht nur in der Virtuosität, sondern in der Empathie. „Hier [in der Operette] zeigte sich …, daß Strauß ein echter Poet war, ein Dichter in Tönen, ein Lyriker, dem Innigkeit geradeso zu Gebote stand wie die andere Seite, die bekanntere seines musikalischen Wesens, der Schwung, die dionysische Trunkenheit. Nachdenkliches ebenso wie Mitreißendes, Feinfühligkeit so gut wie Übermut vermochte er in seiner Musik auszudrücken.“ (Pahlen: S. 295) Wie Franz Schuberts Musik immer von einem Hauch Melancholie umgeben war, atmeten Schanis Werke Lebensfreude und Leichtigkeit; sie waren dennoch
niemals nur reine Vergnügungsmusik. Schubert wurde einst gefragt, ob er nur traurige Musik komponiere. Er entgegnete: „Ja, gibt es denn überhaupt eine andere?“ Strauß hätte wohl gegenteilig geantwortet.
Sein Erfolg war universell. „Es ist erstaunlich, wie die Meinungen im Falle Strauß einmütig übereinstimmen, gleichviel, ob sich eine
bedeutende Persönlichkeit oder der kleine Mann, ob sich der Anhänger von Unterhaltungsmusik oder der Empfindsame dazu äußert, auch Nichtmusiker oder Musiker, die sonst fast nie unter einen Hut zu bringen sind, ja selbst – was das Seltenste ist – die Musiker aller Richtungen.“ (Pahlen: S. 293)
Schani wollte den Menschen mit seiner Musik Freude bringen und sie den Alltag vergessen lassen. Das gelang ihm. Seine Musik vereinte Gegensätze, sie vereinte die Menschen – nicht durch Worte, sondern durch Töne. Bei seinen Konzerten gab es keine Standes-, keine Religionsunterschiede. Alle tanzten – Junge und Alte, Adelige und Bürgerliche. Auch die äußeren Regionen der Monarchie sowie die umliegenden Länder waren von seiner Musik berauscht – Deutschland, Frankreich, sogar Russland.
Es war an der Seine – bei der Pariser Weltausstellung 1867 –, wo die Donau zwar nicht zum ersten Mal ihre blaue Farbe erhielt – sein
berühmtestes Werk, der Donauwalzer („An der schönen blauen Donau“), war bereits öffentlich aufgeführt worden –, aber hier erstmals einem Massenpublikum präsentiert wurde und von da an große Popularität erhielt. Und selbst in Amerika, vor 100.000 Zuschauern, bewies Johann Strauß: Musik kennt keine Grenzen. Im Jahr 1876 luden ihn die Vereinigten Staaten zu ihren Festivitäten anlässlich des hundertjährigen Jubiläums ihrer Unabhängigkeit ein. „Eine Festhalle war errichtet worden, in der
hunderttausend Zuhörer Platz fanden. Zehntausend Musiker im Orchester, zwanzigtausend Sänger. Es ist ein überwältigender, beinahe beängstigender Eindruck.“ (Pahlen: S. 288) Zeit seines Lebens schuf Johann Strauß Sohn rund 600 Werke an Tanzmusik und Märschen, 15 Operetten, eine Oper und ein Ballett.
Der Unvergessene: Eine Ära endet
Als der Walzerkönig seine letzten Tage und Stunden verbrachte, summte er keines seiner zahlreichen eigenen Werke. Er hatte – wie seine Frau Adèle berichtete, die während dieser Zeit seine Hand hielt, die Komposition seines ehemaligen Musiklehrers Josef Drechsler „Brüderlein fein“ (Text: Ferdinand Raimund) auf den Lippen.
Brüderlein fein, Brüderlein fein,
zärtlich muß geschieden sein.
Brüderlein fein, Brüderlein fein,
´s muß geschieden sein.
Denk manchmal an mich zurück,
schimpf nicht auf der Jugend Glück.
Brüderlein fein, Brüderlein fein,
schlag zum Abschied ein.
Johann Strauß Sohn starb am 3. Juni 1899 an einer Lungenentzündung – in einer Welt, die sich verändert hatte, aber noch vom Strahlen seiner Musik getragen wurde. „Heute noch weiß man, wie sich dieses Ereignis in wenigen Stunden herumsprach und die Kapellen im Prater … traurig verstummten und das tanzende, das glückliche Wien begriff, dass eine musikalische Epoche zu Ende war.“ (Chorherr: S. 115) – Wien schien plötzlich stillzustehen. Jenes Wien, das im Dreivierteltakt pulsiert hatte, zwischen Biedermeier und Jahrhundertwende, zwischen Hoffnung und Vorahnung.
Strauß musste die Zerstörung von allem, was ihm lieb und vertraut war, nicht mehr miterleben. Auch nicht, dass nach einem Weltkrieg, der Zauber und Prunk verschlang, ein zweiter folgte, der den Rest mit sich riss, der noch von der goldenen Epoche, die er mitgeprägt hatte, übrig war.
Vielleicht ist das der Grund, warum der Donauwalzer, der jedes Neue Jahr einschwingt, die Herzen der Österreicher bis heute öffnet und zugleich schwermütig werden lässt, warum er uns Freuden-, Stolz- und Wehmutstränen in die Augen treibt, weil wir diese längst vergangene Blütezeit noch immer fühlen können – durch all die Zeit. Die uns eines
im Bewusstsein hält: Kunst kann nicht sterben. Und auch der unsterbliche Mensch dahinter, Johann Strauß Sohn, bleibt mehr als ein Komponist: Er ist ein Vorbild – für Sanftmut mit Haltung, für Freude mit Tiefe, für Musik als Brücke zwischen den Menschen.
Quellen:
Chorherr, Thomas: Große Österreicher – 100 Portraits von bekannten Österreichern; Ueberreuter, 1985
Filmbiografie: Die Strauß-Dynastie; Regie: Marvin J. Chomsky; Produktion: Kurt J. Mrkwicka & Werner Swossil; 1989
Ingenheim, Marie Luise von: Die Strauß Saga – Liebe im Dreivierteltakt; hpt, 1991
Leitich, Ann Tizia: Damals in Wien – das große Jahrhundert einer Weltstadt, 1800–1900; Forum-Verlag
Pahlen, Kurt: Johann Strauß und die Walzerdynastie; Heyne, 1997
Weissensteiner, Friedrich: Zwischen Idylle und Revolution –ungewöhnliche Biedermeierporträts; Ueberreuter, 1995
Wiener Institut für Strauß-Forschung (WISF)
Wikipedia: Revolutions-Marsch
Bild: Pixabay