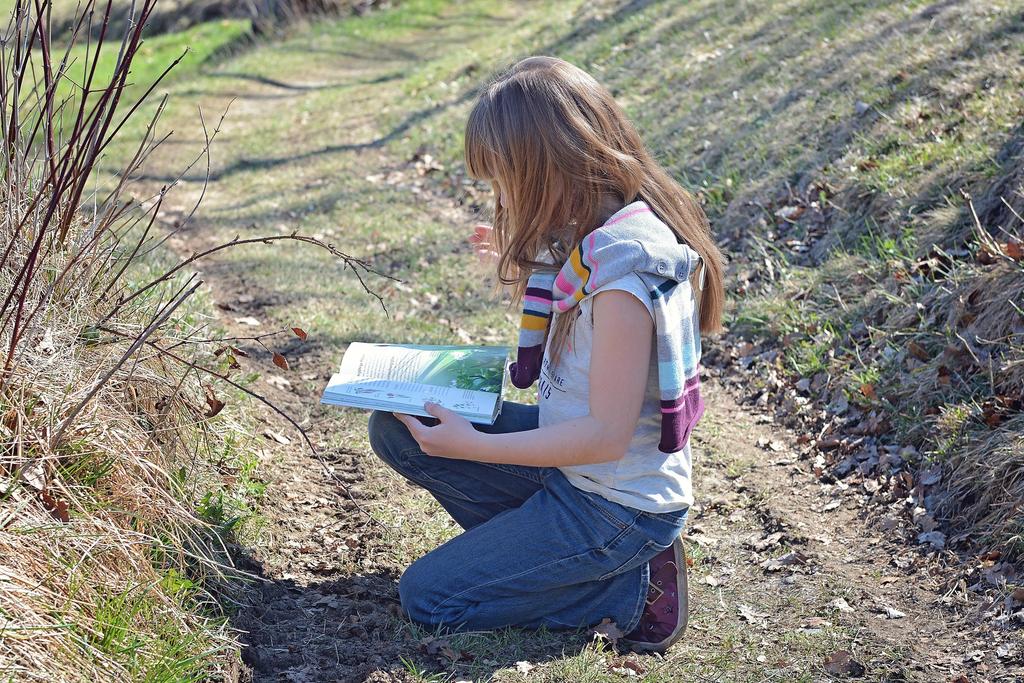FreiSein durch das Beschreiten von selbstbestimmten Bildungswegen
Seit 2007 wird alljährlich am 15. September der Tag der Bildungsfreiheit begangen. Damals haben französische Elterninitiativen erstmals dazu aufgerufen, selbstbestimmten Bildungswegen ausreichende Beachtung zu schenken. Denn, so die Proponenten, es gebe – anders als von den meisten Menschen gedacht – nicht für jedes Kind die passende Schule. Und: Nicht die jungen Menschen müssten an die Bildungseinrichtungen, sondern jene an die Bedürfnisse der Heranwachsenden angepasst werden; ein hehres Ziel.
International betrachtet, fristet dieser „Feiertag“ ein eher stiefmütterliches Dasein. Die, die für die Bildung in den Staaten bzw. weltweit zuständig sind, das sind Behörden, Politiker, aber auch NGOs wie die UNESCO, betrachteten die Initiative ohnehin von Anfang an mit äußerster Skepsis. Zu sehr sind diese Institutionen davon überzeugt, dass Bildung nur in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Universitäten erworben werden kann.
Der Ausgangspunkt für alle Beteiligten ist allerdings derselbe: Es muss ein Recht auf Bildung geben. Die Ansätze, wie dieses umgesetzt wird, unterscheiden sich jedoch grundlegend. In Österreich etwa wird dieses Recht durch eine Pflicht garantiert, die so genannte Unterrichtspflicht nämlich. Diese kann durch den Besuch staatlicher sowie privater Bildungsanstalten erworben werden oder im Rahmen der häuslichen Erziehung (im Kindergartenalter) bzw. des häuslichen Unterrichts (im Pflichtschulalter) absolviert werden. Im letzteren Fall besteht die Notwendigkeit, alljährlich Externistenprüfungen in allen relevanten Fächern abzulegen, was spätestens ab der Mittelstufe ein ziemlicher Aufwand ist. Zuletzt wurden ja – bewirkt durch einen Run auf das Homeschooling in der so genannten Corona-Zeit – auch die Bedingungen dafür verschärft. So ist es nun nicht mehr möglich, die Leistungsnachweise an der Schule der eigenen Wahl zu absolvieren; zudem sind die Prüfungsvorgaben mittlerweile zentralisiert, eine individuelle Vorgangsweise, die an den Interessen und Bildungsbedürfnissen der jungen Menschen orientiert ist, wird damit verunmöglicht. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, diese individuellen Bildungswege so weit wie möglich zu verhindern.
In dieser Zeit zeigte sich, dass es ein völlig gegensätzliches Verständnis für „häusliche Lernwege“ gibt. Für die meisten war es wichtig, dass ihre Kinder weiterhin zumindest für einen Teil des Tages fremd betreut werden, dass sich der Schulbetrieb also an den PC zuhause verlegt, sie aber weiterhin wenig bis nichts mit dem Lernen zu tun haben, um möglichst ungehindert der für das Erzielen des Lebensunterhaltes nötigen Erwerbsarbeit nachgehen zu können. In anderen Fällen kamen die Eltern, die sich erstmals intensiv mit der Bildung ihrer Kinder beschäftigten und sich intensiv am Lerngeschehen zu beteiligen versuchten, schnell an ihre Grenzen. Auch stellte sich bald die Frage, ob Mütter und Väter als Lehrer ihres Nachwuchses taugen oder gar die besseren Pädagogen sind.
Reichlich Erfahrung mit dem Thema haben jene gesammelt, die trotz gesetzlicher Hürden und Gegenwind von den Behörden, ihren Kindern selbstbestimmte Bildungswege ermöglichen. So haben sich Eltern, die dem dringenden Wunsch ihres Sprösslings nachkommen, nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen zu müssen, in Freilerner-Netzwerken zusammengefunden. Mit dem freischaffenden Philosophen Bertrand Stern haben sie einen Fürsprecher gefunden; dessen Halbbruder André Stern ist in der Szene vor allem durch sein Buch „Und ich war nie in der Schule“ bekannt. Beide sind Söhne des erst kürzlich 100-jährig verstorbenen Begründers von Malorten Arno Stern.
Bertrand Stern hat das Konzept des Frei-Sich-Bildens entwickelt und war auch maßgeblich am Entstehen des Filmes „Caraba – Leben ohne Schule“ beteiligt, in dem er in einem Kurzauftritt die Rolle eines deutschen Verfassungsrichters übernimmt, der allen Schülern Bildungsfreiheit ermöglicht. In Deutschland existiert nämlich im Gegensatz zu Österreich sogar ein so bezeichneter „Schulanwesenheitszwang“, also die Verpflichtung, eine Schule vor Ort zu besuchen. Für Bertrand Stern ist die Basis aller Bildungsüberlegungen der junge Mensch selbst, der vom ersten Tag seines Lebens an als Subjekt wahrgenommen werden müsse und keinesfalls – wie in Bildungssystemen üblich – zum Objekt der Erziehung bzw. der Bildung gemacht werden dürfe. Neben seinen Vortragsreisen unterstützt er Familien auch ganz konkret bei der Vorbereitung auf das Beschreiten des Rechtsweges gegen diese Zwangsverpflichtung. Das Bildungssystem – und da ist er sich mit der Psychologin Franziska Klinkigt einig – ist voller struktureller Gewalt, die UN-Kinderrechtskonvention, die großen Wert auf Partizipation legt, wird dabei zum Großteil ignoriert, selbst von der UNO-Kinderhilfsorganisation UNESCO. Auch für die ist Schule das Allheilmittel, um Kinder zu einem eigenständigen, unabhängigen Leben zu befähigen.
Was aber tun, wenn das eigene Kind plötzlich den Wunsch äußert, nicht mehr zur Schule zu gehen?
Hierfür gibt es wohl eine Fülle von individuellen Lösungen. An dieser Stelle sollen nur ein paar Möglichkeiten, die vornehmlich für Österreich gelten, genannt werden:
Zum einen lässt sich der Weg des Homeschoolings beschreiten, der allerdings am Ende jedes Schuljahres die schon oben beschriebene Hürde der Externistenprüfungen unter den derzeit geltenden, recht strengen Bedingungen beinhaltet.
Andererseits kann man versuchen, sich diesem Zwang zu entziehen, in dem man diese Notwendigkeit ignoriert. Dabei unterstützt werden kann man durch die Vernetzung mit anderen Eltern oder durch Lerninitiativen wie etwa WINGS, die die Lernenden mit Fachpersonal online oder vor Ort auf ihren individuellen, selbstbestimmten Bildungswegen professionell begleiten. Als Folge eines solchen Vorgehens drohen Verwaltungsstrafen wegen „Schulpflichtverletzung“ und das mitunter mehrmals pro Schuljahr. In einer wachsenden Zahl von Fällen wird derzeit auch ein Familiengerichtsverfahren zur Klärung der Obsorge in Bildungsangelegenheiten angestrengt. Zu bemerken ist aber, dass so mancher Richter in diesen Fällen mittlerweile versucht, den jeweiligen Einzelfall zu bewerten und sich nicht auf bereits vorliegende Urteile aus anderen Verfahren beruft, was bei den Betroffenen die Hoffnung erweckt, dass es sich á la longue zum Respektieren dieser Vorgangsweise entwickelt.
Und zuletzt gibt es Familien, die sich aus dem Heimatland abmelden und sich auf Reise begeben, wodurch sie der Gesetzgebung eines Staates entzogen sind. Das erhoffte Bildungsparadies, wo nach den Bedürfnissen der Kinder agiert wird, gibt es nämlich noch nicht wirklich, auch wenn es in dem einen oder anderen Land durchaus schon Regelungen gibt, die wesentlich individuellere Bildungswege ermöglichen.
Folgt man den Perspektiven von Bertrand Stern, dann sollte ein Staat dem von Natur aus grundsätzlich neugierigen und damit wissbegierigen und bildungshungrigen jungen Menschen alles das zur Verfügung stellen, was er auf seinem Lernweg dazu braucht – und das natürlich kostenfrei. Schon Ivan Illich, auf den sich Stern beruft, hat in den 1970er-Jahren die Hoffnung geäußert, dass mit der damals noch in den Kinderschuhen steckenden Informationstechnologie, also dem Computer, Bildungsnetzwerke entstehen, die genau diesem Zweck der individualisierten und differenzierten Lernbegleitung dienen. Das hat sich bis heute nicht bewahrheitet, sind sich die Verantwortungsträger und an den Schalthebeln der Macht Sitzenden doch der Gefahr bewusst, dass damit das seit jeher in Bildungssystemen verankerte, durchaus versteckte Prinzip, funktionstüchtige und gehorsame Bürger hervorzubringen, zum Scheitern verurteilt wäre.
Vielleicht mag man sich ja in nicht allzu ferner Zukunft auf einen Zwischenschritt einigen, wie das etwa in Deutschland im Fall von Abtreibungen oder in Österreich im Bereich des assistierten Suizids der Fall ist: Man gewährt unter bestimmten Bedingungen Straffreiheit und ermöglicht auf diese Weise menschenwürdige Lösungen.
https://entfaltungsbegleitung.wordpress.com
Bild von Pixabay