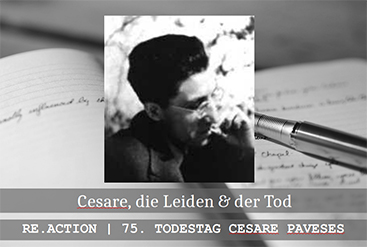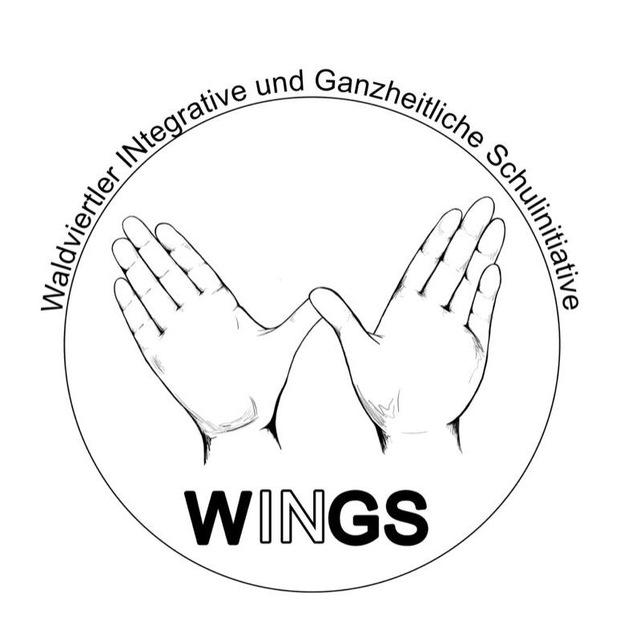Text von Michael Karjalainen-Dräger
Es war Ende der 1980er-Jahre als ich wieder einmal – wie damals öfter – im Kino saß. Wie ich auf den Film „A Man in Love“ gekommen war, lässt sich für mich heute nicht mehr restlos nachvollziehen. Möglicherweise war es das in dem Streifen gegebene Szenario eines Films im Film. Im Rahmen des Kunstunterrichts an meinem Gymnasium hatten wir einige Jahre zuvor François Truffauts bereits 1973 entstandenes Werk „La nuit américaine“ gesehen, um uns mit dem Filmemachen vertraut zu machen. In meinem Freundeskreis entstanden in der Oberstufe dann ja auch einige Filme auf Super 8, zu einem durfte ich das Drehbuch schreiben, in zweien spielte ich auch die Hauptrolle. 1981 war auch die Verfilmung des Romans „The French Lieutenants Women“ mit Meryl Streep und Jeremy Irons in die Kinos gekommen, wobei auch dieser Film in der Welt der Schauspieler inszeniert wurde, die Fowles Romanze auf den Set bringen. Andererseits könnte mich auch meine Faszination für Schriftsteller dazu geführt haben, spielt Peter Coyote an der Seite von Greta Sacchi doch einen Schauspieler, der in die Rolle des italienischen Schriftstellers Cesare Pavese schlüpft.
Die auf diese Weise erfolgte Begegnung mit Pavese, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, hatte jedenfalls bis in die Gegenwart reichende Folgen. Der Schriftsteller hat sich am 27. August 1950, am Höhepunkt seiner Karriere, in einem Turiner Hotel im Alter von 42 Jahren mit einer Überdosis Schlafmittel das Leben genommen. Sein Abschiedsbrief war kurz aber bedeutend und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen schrieb er ihn auf sein erklärtes Lieblingsbuch, die von ihm verfassten „Dialoghi con Leucò“, zum anderen beschrieb die Botschaft seine Lebenseinstellung, die ihn letztlich auch zu dieser Tat geführt hatte: „Ich verzeihe allen und bitte alle um Verzeihung. Seid ihr zufrieden? Macht nicht zu viel Klatsch!“
Die Sehnsucht nach dem Tod zieht sich durch sein Leben, das in seinem Tagebuch „Das Handwerk des Lebens“ gut dokumentiert ist. „Und ich weiß, daß ich für immer dazu verdammt bin, bei jedem Hindernis oder Schmerz an Selbstmord zu denken. Das ist es, was mich entsetzt: mein Prinzip ist der Selbstmord“, heißt es da etwa. Und als er 1949 seine Aufzeichnungen beendet, nicht ohne zuvor all seine Werke chronologisch aufgelistet zu haben, schreibt er abschließend: „Meine öffentliche Rolle habe ich gespielt- so gut ich konnte. Ich habe gearbeitet, habe den Menschen Dichtung gegeben, habe das Leid vieler geteilt… Je bestimmter und genauer der Schmerz ist, um so mehr schlägt der Lebenstrieb um sich und fällt der Gedanke an Selbstmord…All das ist ekelhaft. Nicht Worte. Eine Geste. Ich werde nicht mehr schreiben.“
Aber es war nicht nur dieses Tagebuch, das ich mir damals nach dem Film gekauft habe, sondern ich versuchte alle seine Werke auf Deutsch zu ergattern, was damals nicht abschließend gelungen ist. Erst kürzlich bin ich auf sein letztes Werk „Der Mond und die Feuer“ gestoßen, dass ich online lesen konnte. Und die Dialoge mit Leuco fehlen mir noch immer. Besonders angetan war ich von seinen Gedichten, die ich in der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Hunger nach Einsamkeit“, gelesen habe. Eine Textstelle schwirrt mir immer noch im Kopf herum, sie lautet: „Der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben.“ Auch englischsprachige Lyrik findet sich in dem Band, war Pavese doch nach seiner Promotion über den amerikanischen Autor Walt Whitman auch als Übersetzer u.a. von Melvilles Moby Dick und Werken von James Joyce und Charles Dickens ins Italienische tätig.
In guter Erinnerung blieb mir eines seiner Gedichte mit dem Titel „Last blues, to be read some day“:
’T was only a flirt
*you sure did know -*
someone was hurt
long time ago.
All is the same
time has gone by –
some day you come
some day you’ll die.
Someone has died
long time ago -*
someone who tried
but didn’t know.
Sein Prosawerk dreht sich um die gesellschaftlichen Zu- und Umstände in seiner Heimat zu seinen Lebzeiten. Der Schriftsteller, 1908 geboren, hat beide Weltkriege erlebt, die Zeit des Faschismus hat ihn 1945 in die Kommunistische Partei Italiens eintreten lassen. Zudem lässt sich aus seinen Romanen auch sein durchaus kompliziertes Verhältnis zum weiblichen Geschlecht herauslesen. Seinen Schreibstil bezeichnet er selbst als „Immagine-Racconto“, als Bild-Erzählung; seine Ich-Erzähler beschreiben ihre Gedanken und Eindrücke, in der Handlung wird auch viel aus Erinnerungen geschöpft; für manche ist seine Art zu schreiben handlungsarm. An seiner Art zu schreiben fasziniert gerade eben dieses sehr Emotionale, Persönliche und dadurch auch sehr Eindrückliche und Bewegende. Das wirkt viel mehr und viel intensiver nach als die Geschichten, die er in seiner Prosa erzählt; und es weckt eine Sehnsucht, seine Bücher noch einmal und noch einmal zu lesen.
Von den Amerikanern – und das kommt in den deutschen Übersetzungen leider nicht zum Ausdruck – hat er das Schreiben von Dialogen im Dialekt oder Slang übernommen, was für die italienische Literatursprache ein Tabubruch war, diese Möglichkeit aber für andere, ihm nachfolgende Autoren geöffnet hat.
Es gäbe noch viel zu sagen und viel zu schreiben; was aber bleibt ist die Erinnerung an einen Menschen, dessen Leben vordergründig von Leiden, Leidenschaft, Einsamkeit und Sehnsucht nach dem Tod geprägt war. In seinem Werk jedoch geht er seinen Lesern damit nicht auf die Nerven, er hebt seine Protagonisten vielmehr darüber hinaus und geht in seinem Schreiben damit auch einen Weg, den er im realen Leben niemals geschafft hat. Diese Ambivalenz lässt sich zwischen den Zeilen wahrnehmen, da schreibt einer, der sich möglicherweise nicht so sehr den Tod, sondern ein anderes, besseres Leben gewünscht hat. Aus dieser Perspektive mag seine Entscheidung, dieses Leben zu beenden, das er für erfüllt gehalten hat, gut nachvollziehbar sein.
Live long and prosper, Cesare!
Bildrechte:
Cesare Pavese
Twice25, Public domain, via Wikimedia Commons