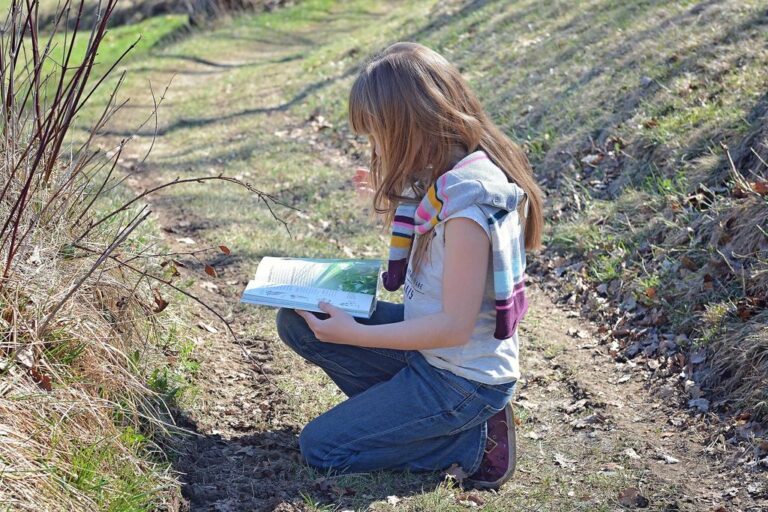Der Mensch ist ein soziales und friedliches Lebewesen. Das ist seine Natur. Fühlt er sich aber bedroht, wird er gefährlich. Diese Eigenschaft ist Teil einer Überlebensstrategie, die ihm die Evolution in die Wiege legte. Versagt seine Selbstkontrolle und fallen die Barrikaden der Vernunft, offenbart sich die Grausamkeit, die in jedem Menschen lauert. Diese Kenntnis ist bedeutsam, wenn eine Gesellschaft auf Krieg eingestimmt werden soll.
Mit Leichtigkeit werden die intellektuellen, religiösen und rechtlichen Ketten aus Psalmen, Geboten, Regeln und Paragrafen gesprengt, die die Zivilisation dem Menschen angelegt hat.
Er wischt rationale Hemmungen beiseite, zerschmettert moralische Bedenken und bricht sich Bahn. Das Unbelebte zu zerstören, alles Lebendige zu quälen und zu töten und seinesgleichen den Schädel einzuschlagen, wird zum Kinderspiel. Nicht einmal das eigene Fleisch wird verschont. Im Augenblick der Explosion outet sich die Krone der Schöpfung als Urvieh.
Menschliche Destruktivität
Sieht sich der Mensch mit einer Situation konfrontiert, die er als bedrohlich wahrnimmt oder als konkrete Gefahr für Leib und Leben einstuft, versucht er zu flüchten, um sich in Sicherheit zu bringen. Ist ihm die Flucht unmöglich, erstarrt er vielleicht vor Angst und ergibt sich in sein Schicksal. Ein Angriff in Form physischer Gewalt ist aber ebenso denkbar. Es ist eine „defensive“ Aggression, die der Verteidigung der „vitalen Interessen“ des Lebewesens dient. So formulierte es der Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm, der sich in seinem 1974 veröffentlichten Buch „Anatomie der menschlichen Destruktivität“ mit den Ursachen menschlicher Gewalttätigkeit auseinandersetzte (1).
Das Geschehen wird durch die Absicht diktiert, sich der Bedrohung zu entledigen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Dieses Ziel hat höchste Priorität. Die Wahl der Mittel unterliegt dabei unter anderem subjektiven Einschätzungen, Erfahrungen mit ähnlichen Situationen und so weiter. Das heißt nicht, dass der Mensch kein Pardon kennt, selbst wenn es um sein Überleben geht. Er ist zum Mitleid fähig.
Ist die Bedrohung aufgehoben, lässt die Aggression langsam nach. Was als bedrohlich angesehen wird, bleibt aber eine Frage der Interpretation. Durch diese Subjektivität ist eine Umformung der Selbstverteidigung zu einem Akt eigener Bedrohung beziehungsweise offensiver Gewalt ebenso möglich wie die Begründung von Brutalität. Dadurch verschwimmen die Grenzen zur bösartigen Aggression, das heißt, zu einer rein destruktiven Gewalt, die sich laut Erich Fromm nur beim Menschen bis ins Irrationale steigern kann.
Beispiele für die Irrationalität von Gewalt gibt es unzählige. Die meisten lassen sich in der Reflexion mit Störungen der Psyche erklären, auch wenn bei der ersten Betrachtung die Emotionen das kritische Denken überlagern.
Attackiert eine junge Frau ihr Baby, dessen Existenz sie aus irgendeinem Grund stört, wirft es anschließend in eine Mülltonne — wie Ende 2024 in Wien geschehen — und das Kind verstirbt, ruft die Handlung bei Außenstehenden sicherlich völliges Unverständnis hervor. Eine tiefe Auseinandersetzung über den psychischen Zustand der Frau bleibt aber aus.
Ein Fall aus Rosenheim (Bayern) wirkt nicht weniger verstörend. Eine 39-Jährige versuchte sich das Leben zu nehmen, nachdem sie im Laufe des 24. Dezember oder in der Nacht auf den 25. Dezember 2024 zwei ihrer leiblichen Kinder umgebracht hat (2). Auch dieses Ereignis führt nicht dazu, sich intensiv mit den Motiven und Bedingungen zu beschäftigen, die einer solchen Handlung vorausgehen, um daraus soziale Konsequenzen abzuleiten. Die Taten bleiben unreflektiert, verblassen in der Erinnerung und verschwinden schließlich aus dem Gedächtnis.
Das Grauen hat noch mehr Facetten. In einer U-Bahn in New York City zückte einige Tage vor Weihnachten ein Mann ohne erkennbaren Anlass ein Feuerzeug, zündete die Kleidung einer schlafenden Frau an, setzte sich auf eine Bank und sah ihr beim Verbrennen zu. Irre, nicht wahr?! (3) Die Schlagzeilen gleichen sich: Schrecklich! Unfassbar! Wahnsinn! Sind diese „Tragödien“ medial verarbeitet und mit den politisch üblichen Forderungen nach härteren Strafen für die Täter und mehr Sicherheit kommentiert, verschwinden sie als emotionslose Fallzahlen in einer der vielen Statistiken, die das alltägliche Sterben dokumentieren.
Extrem gefährlich
Innerhalb von Subkulturen wie Polizei, Militär oder Mafiaorganisationen, die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen oder zur Problemlösung anwenden, sie als „Normalität“ ansehen, ihre eigene Destruktivität bei der Selbsteinschätzung und -bewertung ausblenden oder Gewalt mit Orden, Beförderungen oder materiellen und sozialen Zuwendungen belohnen, was einer Aufwertung des Handelnden entspricht, wird die individuelle Gewaltbereitschaft gefördert, statt sie zu unterbinden.
Im Sinne des Lernens am Modell wird den „lernenden“ Beobachtern vermittelt, dass der persönliche Status durch die Anwendung von Gewalt innerhalb und gegebenenfalls auch außerhalb der Gruppe verbessert werden kann.
Unter den im Fußballsport berüchtigten Hooligans finden sich beispielsweise Charaktere, die sich als Krieger verstehen. Für sie ist Gewalt die buchstäbliche Lösung. Sie konstruieren sich eine Welt des Kampfes und suchen in den Gefahren der körperlichen Auseinandersetzung den Schuss Adrenalin, den ihnen die geregelte Einöde des zivilisierten Lebens verweigert. Ist die Bühne des Sports versperrt, verabreden sich die Gleichgesinnten irgendwo anders zum Gewaltakt.
Die räumliche Flexibilität wird unterstützt durch die Leichtigkeit, mit der sich mittels mobiler Endgeräte Fotos und Videos der Prügeleien anfertigen und über das Internet verbreiten lassen. Das digitale Kolosseum erwartet die Gladiatoren. Zersplitternde Knochen und Tritte gegen den Kopf werden auf einschlägigen Webseiten, die sich nicht in der Anonymität des „Darknet“ verstecken, von einem voyeuristischen Publikum mit Aufmerksamkeit und Likes belohnt. Ihr Applaus veredelt den blutigen Geschmack des Schauspiels. Wen könnte es wundern?! Gewalt ist schon seit Ewigkeiten ein festes Segment im Unterhaltungsmix.
Extreme Ausprägungen von Gewalt zeigen sich bei Serienmördern. Anhand ihrer übergeordneten Motive lassen sich vier Typen herausfiltern. Der visionäre „Serial killer“ tötet Menschen, weil es ihm eine innere Stimme befiehlt oder ihn Visionen zu seinen Taten anstiften. Der missionsorientierte Mörder bringt Menschen um, die sich durch bestimmte Eigenschaften und Merkmale auszeichnen und genau deshalb aus seiner Perspektive schädlich oder gefährlich sind.
Mordlust, teilweise verknüpft mit sexuellen Motiven, treibt den hedonistischen Mörder an. Er labt sich an den Qualen seiner Beute. Der vierte Typus ist machtorientiert.
Als Aggressor übt er uneingeschränkte Kontrolle über seine Opfer aus und hebt dadurch die Bedeutung der eigenen Existenz hervor. Durch die Begehung der Tat wird er zur absoluten Totalität — er ist Herr über Leben und Tod. Mehr Macht kann niemand auf sich vereinen. Die vollkommene Erfüllung, vielleicht am besten zu beschreiben als Göttlichkeit, bleibt dem Täter aber verwehrt. Er wird kein Gott und mordet auf der Suche nach Vollendung weiter. Allen eigen ist das Ausmaß der Empathielosigkeit. Hebt das die Zivilisation aus den Angeln? Nein.
Der eingepreiste Tod
Diese ganzen Vorkommnisse werden analysiert, die Ursachen erforscht und plausible Lösungsvorschläge diskutiert, obgleich die wenigsten Menschen ihr Leben durch physische Gewalt verlieren, die von einem anderen Menschen direkt gegen sie ausgeübt wird. Das hat viel mit der Lebensweise des modernen Menschen zu tun. Erkrankungen an Herz, Lunge und Atemwegen, Diabetes und Alzheimer gehören zu den Top-Killern.
Wird ein Vergleich mit traditionellen Ethnien und den so genannten Völkern ohne Schrift bemüht, die noch weitestgehend isoliert von der modernen Welt existieren, kann die industrielle Zivilisation als ständige Gewaltausübung interpretiert werden. Man denke nur an die mit leckerem Essen überfüllten Supermarktregale, die zum „Einkaufserlebnis“ einladen, während Babys im Sudan an der Brust der Mutter verhungern, weil sie durch Mangelernährung keine Milch geben kann. Dass jährlich fast genauso viele Menschen an den Folgen von Überfressung sterben wie an den Auswirkungen von Hunger, ist eine Absurdität der weltweit herrschenden ökonomischen Verhältnisse.
Die im wirtschaftlichen Interesse verlangte Hypermobilität, die insbesondere das Auto zum unverzichtbaren Fortbewegungsmittel machte, liefert ein weiteres anschauliches Beispiel. Etwa 1,2 Millionen Leben werden pro Jahr durch Verkehrsunfälle ausgelöscht. Die Mobilität bringt also mehr Menschen um, als es alle aktiven Serienmörder auf dem Planeten gemeinsam zu tun vermögen.
Paradoxerweise taugen ihre Taten aber dazu, Angst und Schrecken zu verbreiten, während man der Mordmaschine Hypermobilität huldigt. Wird dann noch argumentiert, dass an der Automobilindustrie Abermillionen Jobs und der „Wohlstand“ der Gesellschaft hängen würden, was unzweifelhaft stimmt, ist der Schluss naheliegend, dass im ökonomischen Wachstum der Tod von Abermillionen Menschen ganz bewusst eingepreist wird. Und das ist lediglich ein Ausschnitt des Horrors, der die industrielle Gesellschaft begleitet.
Es drängt sich daher die Frage auf, ob die ökonomische Ordnung nicht die wirkliche Bedrohung darstellt, die jeder fürchten sollte.
Diese Diskussion wird aber vermieden. Würde Gewaltausübung grundsätzlich geächtet und verboten, wäre eine Neuordnung der Ökonomie unvermeidlich. Die gleichmäßige Verteilung des Reichtums ist eine der Konsequenzen. Dieser sozial-evolutionäre Quantensprung, der im Zeitalter von Robotik und Künstlicher Intelligenz möglich erscheint und eine weitestgehende Befriedung der Menschheit erwarten lässt, übersteigt aber die Vorstellungskraft.
Die Referenzen finden sich bei den Urvölkern, also weit abseits der Zivilisation, denen Privatbesitz praktisch fremd ist, da sie als echte Gemeinschaften die vorhandenen Ressourcen miteinander teilen und sich mit Gewalt vom Außen distanzieren. Sie sind im ständigen Kriegszustand. Oder besser ausgedrückt: Der Weg zurück in die Wildnis erscheint fürchterlicher als der freiwillige Verbleib im goldenen Käfig. Dieser Randaspekt erklärt natürlich nicht, warum sich die allgemeine Aufmerksamkeit recht einfach auf ausgewählte Gewalttaten lenken lässt, die in der Art und Weise ihrer Ausübung zwar erschreckend sind, aber den Bestand der Zivilisation nicht gefährden können. Dies bleibt der organisierten Gewalt vorbehalten, die sich im Konstrukt Staat versteckt, der gerade mit den Konzerngiganten und Monopolen verschmilzt.
Täter, Opfer, Zeuge, Profiteure
Seine destruktivsten Varianten sind Krieg und Massenmord. Sie stellen alle bekannten Extreme in den Schatten. Um diese Apokalypse zu realisieren, ohne als Täter aufzufallen, bedarf es einer gewissen Vorbereitung der Gesellschaft. Sie muss davon überzeugt werden, dass nicht nur die Gewalt des Staates, manifestiert in Polizei, Militär und sonstigen Gewaltorganisationen, eine gute Gewalt ist, sondern allein die Herrschaft weiß, wie diese Gewalt „Gutes“ verrichten kann. Sie wird im Handlungsspektrum der Organisationsstruktur als (effektives) Werkzeug der Interessendurchsetzung und Zielerreichung etabliert, also nicht als defensive Aggression im Verständnis von Erich Fromm, sondern als allgemein akzeptierte — im Kern offensive und damit bösartige — Lösungsoption. Diesen Aspekt gilt es zu verschleiern.
Die Ethnologie bemüht in der Regel soziologische Modelle, um die Wechselwirkungen zwischen struktureller, kultureller und personaler Gewalt zu beschreiben. Dabei bleibt ein Aspekt auf der Strecke, der für das Verständnis des Gewaltbegriffs tragend ist: Menschen können anderen Menschen Gewalt antun und ihnen Schaden zufügen, ohne ihr Handeln als Gewalt zu verstehen.
In der pazifistischen Dimension bedarf es daher der Klarheit, dass eine Distanzierung von Gewalt nicht nur verbunden ist mit der Ausgrenzung all jener, die Gewalt ausüben oder fordern, sondern die Ablehnung von Gewalt auch immer die Ablehnung aller Strukturen beinhalten muss, die Gewalt ermöglichen.
Deutlicher gesagt: Es gibt keine gute Rüstungsindustrie. Es gibt keine gute Polizei. Es gibt kein gutes Militär. Es gibt keine gute Staatsgewalt. Und so weiter. Diese Unmissverständlichkeit gilt es zu beseitigen, um ein Volk auf kriegerische Handlungen einzustimmen. Zu den Hebeln, die herrschende Regime bedienen, um dies zu schaffen, gehört die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht, um sich gegen „Feinde“ verteidigen zu können. Wer welche sucht, der wird sie finden.
Das Dreieck der Gewalt, eine von David Riches 1986 vorgestellte Theorie (4), die sich auf die Perspektive der Handlungsakteure Täter, Opfer und Zeuge bezieht, ist durch eine leichte Modifikation geeignet, um zu verdeutlichen, warum die externe Bewertung von Gewaltakten im Sinne der Instrumentalisierung dazu taugt, die notwendige Gewaltbereitschaft hervorzubringen.
Riches, der unter physischer Gewalt eine Strategie verstand, die für die Erfahrung sozialer Interaktion fundamental ist, ging davon aus, dass ihre Bewertung wesentlich von dem (oder den) Zeugen abhängt. Als Beobachter, der ausdrücklich nicht ins Gewaltgeschehen einbezogen ist, stuft der Zeuge die Handlung als legitim oder illegitim ein. Seine Einschätzung wird durch eventuelle Kenntnisse über die Ursachen, die Form der Gewaltanwendung und -ausübung, ihre erkennbaren physischen Konsequenzen et cetera beeinflusst.
Mit Blick auf die Auswirkungen, die eine Gewalthandlung auf eine Gesellschaft hat, ist es naheliegend, das Dreieck von Riches zu erweitern. Der Grund findet sich in der nachträglichen Interpretation ausgewählter Taten durch politische, wirtschaftliche und sonstige Akteure, die weder Opfer, Täter noch Zeuge sind. Sie verfolgen Einzel- sowie (mittel- oder unmittelbar) gemeinschaftliche Absichten und bewerten das Ereignis entsprechend ihrer Interessen. Vereinfacht gesagt, sind sie „Profiteure“ der Gewalt, die den Zeugen verdrängen und seine Bewertungen überlagern. Dies gelingt durch eine mediale Deutungshoheit, die kritische Hinterfragungen vermeidet und Ängstlichkeit fördert.
Das giftige Angebot
Durch das anhaltende Gefühl persönlicher Bedrohung wird der psychische Ausnahmezustand zur Regel. Der individuelle Drang, sich ins Private zu flüchten und zu isolieren, nimmt zu. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird zum Verlangen. Wer sich bedroht fühlt, sucht nach einer schützenden Instanz, einem Übervater, der von der Angst erlöst. Was individuell logisch ist, fördert in der anonymen Massengesellschaft Entwicklungen, die den Bestand der Zivilisation gefährden.
Einzelne Gewalttaten, Amokläufe und bedenkliche Verhaltensabweichungen, bei denen Menschen und Dinge zu Schaden kommen, zu politisch motivierten Taten umzudeuten und den Bomben- und Granathagel an den Fronten des imperialistischen Kapitals zur Selbstverteidigung zu erklären, sind notwendige Verzerrungen, um eine Ausdehnung des Repressions- und Überwachungsapparats zu begründen, der einer Tendenz als Steigbügel dient, die die Existenz der gesamten Menschheit bedroht: die Militarisierung der Gesellschaft.
Dieses giftige Angebot der „Profiteure“ anzunehmen, bedeutet, im Selbst die Wertvorstellungen des Humanismus zu beseitigen, konstruierte Bedrohungsszenarien und Feindbilder als Realität zu akzeptieren und die eigene Friedlichkeit auszulöschen. Die Selbstzucht weicht der Umerziehung. Wenn sie gelingt, lässt sich das Urvieh im Menschen auf jeden beliebigen „Feind“ hetzen.
Text von: Gunther Sosna
Quellen und Anmerkungen:
(1) Erich Fromm: Anatomie der menschlichen Destruktivität (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1974).
(2) Polizei Bayern (25.12.2024): Familientragödie in Rosenheim: Mutter tötet zwei ihrer Kinder und unternimmt Suizidversuch. Verfügbar auf https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/078021/index.html, abgerufen am 29.12.2024.
(3) ntv (23.12.2024): Schlafende Frau in New Yorker U-Bahn angezündet. Verfügbar auf https://www.n-tv.de/panorama/Schlafende-Frau-in-New-Yorker-U-Bahn-angezuendet-article25450298.html, abgerufen am 27.12.2024.
(4) David Riches: The Anthropology of Violence (Blackwell Pub, 1986).
Hinweis: Das Essay ist der dritte Teil einer vierteiligen Beitragsserie, die unter anderem in der Schweiz im Magazin Zeitpunkt und bei Manova veröffentlicht wurde.
Symbolfoto: Tim Mossholder, Unsplash.com